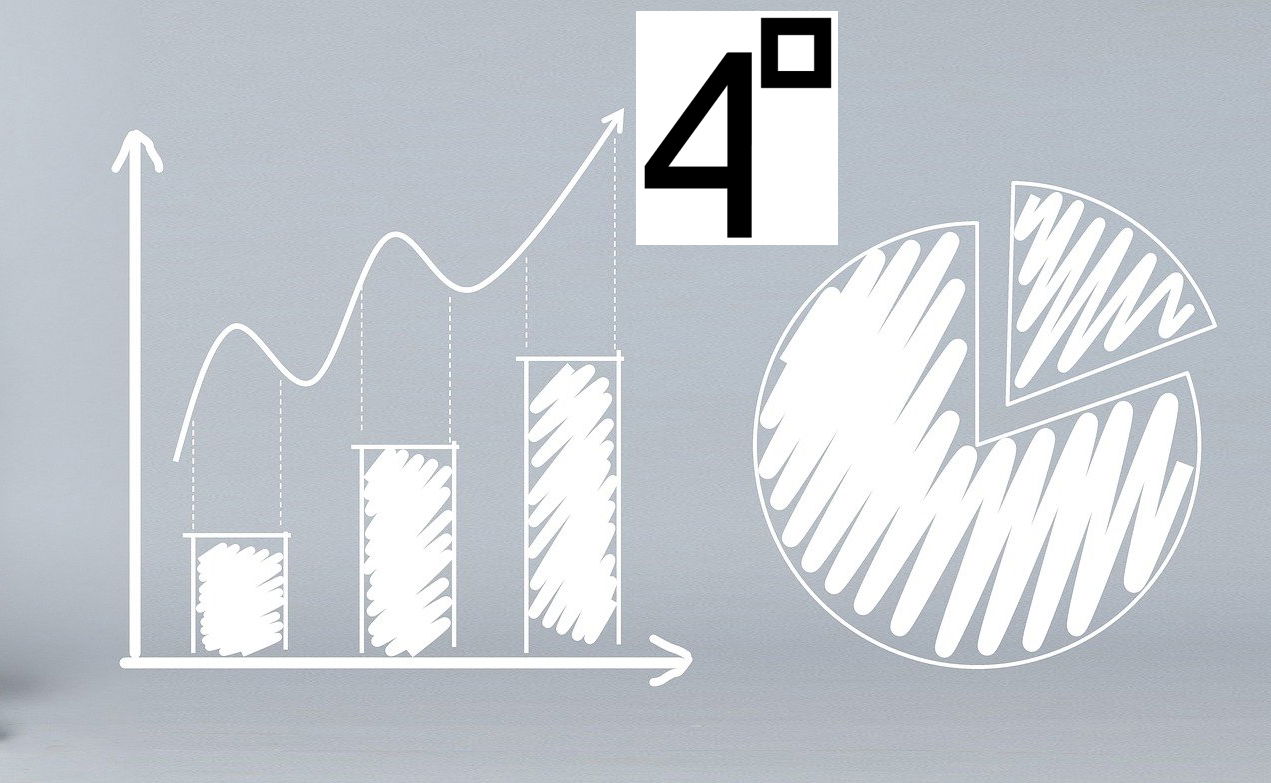Der globale Handelskrieg, angeheizt durch die aggressive US-Handelspolitik, hält die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte fest im Griff. Während vage Hoffnungen auf neue Gespräche zwischen Washington und Peking die Aktienkurse am Freitag kurzzeitig stützten, verdichten sich die Anzeichen für eine spürbare konjunkturelle Abkühlung und zwingen Zentralbanken weltweit zum Handeln. Die Unsicherheit ist groß: Steuert die globale Ökonomie auf eine Zäsur zu, oder ist eine Beruhigung in Sicht?
Märkte im Spannungsfeld: Hoffnung trifft auf Realität
Ein Hoffnungsschimmer oder nur ein Strohfeuer? Die Finanzmärkte reagierten zum Wochenschluss zunächst erleichtert auf Signale möglicher Wiederaufnahmen der Handelsgespräche zwischen den USA und China. Peking ließ verlauten, die Tür für Verhandlungen sei offen – ein verbales Signal, das ausreichte, um den pan-europäischen STOXX 600 Index um rund 0,9 Prozent nach oben zu treiben und sogar die US-Aktienfutures nach zuvor schwachen Quartalszahlen von Tech-Giganten ins Plus zu drehen.
Doch die tiefen Narben des anhaltenden Konflikts sind unübersehbar. Selbst Branchenführer wie Apple beklagen die Belastungen durch die US-Zölle und warnten jüngst vor zusätzlichen Kosten von rund 900 Millionen Dollar allein im laufenden Quartal. Die Nervosität an den Märkten bleibt hoch, zumal auch andere Fronten im globalen Handel unruhig sind. Japan deutete etwa an, seine billionenschweren Bestände an US-Staatsanleihen als potenzielles Druckmittel in künftigen bilateralen Zollverhandlungen mit Washington einsetzen zu können – ein Hinweis auf das Eskalationspotenzial.
Asien im Brennpunkt: Zwischen Konjunktursorgen und Zollängsten
Besonders in Asien sind die Auswirkungen der aktuellen Handelspolitik bereits jetzt schmerzhaft spürbar. Thailand, eine der am stärksten von den US-Maßnahmen betroffenen Volkswirtschaften Südostasiens, wappnet sich aktiv für schwierigere Zeiten. Die thailändische Zentralbank (BoT) hat ihren Leitzins bereits zweimal in Folge gesenkt, auf ein Zweijahrestief von 1,75 Prozent, und signalisiert klare Bereitschaft für weitere Lockerungsschritte, sollte der Handelskrieg weiter eskalieren. Notenbank-Vize Piti Disyatat rechnet für das erste Quartal nur noch mit einem Wirtschaftswachstum von etwa 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr – eine deutliche Verlangsamung nach 3,2 Prozent im Schlussquartal 2024. Mit potenziellen US-Zöllen von bis zu 36 Prozent steht das Land vor enormen Herausforderungen, zumal der geld- und fiskalpolitische Spielraum als begrenzt gilt. Die nächste Zinsentscheidung der BoT steht am 25. Juni an.
Etwas anders stellt sich die Lage in Hongkong dar. Die dortige Wirtschaft überraschte im ersten Quartal mit einem robusten Wachstum von 3,1 Prozent im Jahresvergleich und übertraf damit die Analystenerwartungen deutlich. Doch die Freude darüber wird massiv getrübt durch die sich zuspitzenden globalen Handelsspannungen. Ein Regierungssprecher warnte eindringlich vor den "sichtbar erhöhten Abwärtsrisiken" durch die US-Zölle, die den internationalen Handel und die Investitionsbereitschaft dämpfen dürften. Ein schwächelnder privater Konsum, der im ersten Quartal um 1,2 Prozent zurückging, unterstreicht diese Sorgen bereits.
Europas Reaktion: Zentralbanken im Krisenmodus
Auch in Europa schlagen die Wellen des Handelskriegs hoch und zwingen die Zentralbanken zu Reaktionen. Analysten von Bank of America und Deutscher Bank gehen fest davon aus, dass die Bank of England (BoE) auf ihrer bevorstehenden Sitzung den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent senken wird. Als Hauptgründe werden zwar eine nachlassende heimische Inflation und sinkende Energiekosten genannt, aber explizit auch die konjunkturellen Risiken durch die US-Zölle. BofA rechnet sogar damit, dass die BoE ihre Wachstumsprognosen ab dem zweiten Quartal senken muss, und schätzt den negativen Effekt der Zölle auf rund 0,4 Prozentpunkte. Einige Währungshüter im geldpolitischen Ausschuss (MPC) könnten laut den Banken sogar für eine aggressivere Senkung um 0,50 Punkte plädieren. Insgesamt werden für das laufende Jahr bis zu vier Zinssenkungen in Großbritannien erwartet.
Die Europäische Zentralbank (EZB) steht vor einer ähnlichen, wenn auch komplexen Gemengelage. Die Gesamtinflation in der Eurozone verharrte im April zwar stabil bei 2,2 Prozent und damit leicht über dem EZB-Ziel. Allerdings zog die Kerninflation (ohne Energie und Lebensmittel) überraschend deutlich von 2,4 auf 2,7 Prozent an, was vor allem auf einen Sprung bei den Dienstleistungspreisen zurückgeführt wird – Experten vermuten hier allerdings einen temporären Sondereffekt durch das Osterfest.
Trotz des Anstiegs der Kernrate rechnen viele Beobachter wie Capital Economics fest mit weiteren Zinssenkungen durch die EZB im Jahresverlauf, möglicherweise zwei Schritte bis auf einen Einlagensatz von 1,75 Prozent. Der Grund: Paradoxerweise dürften die US-Zölle für die Eurozone eher disinflationär wirken, indem sie das Wirtschaftswachstum bremsen, den Euro tendenziell stärken und Importe verbilligen. Zudem wächst die Sorge, China könnte überschüssige Produkte verstärkt nach Europa umleiten. Die EZB selbst hat ihre Kommunikation bereits angepasst und signalisiert, dass das Inflationsziel von 2 Prozent quasi erreicht sei, was den Weg für weitere Lockerungen ebnet. Die nächste EZB-Sitzung findet am 5. Juni statt, kurz nach Veröffentlichung der Mai-Inflationsdaten.
Ein kleiner Lichtblick kommt derweil aus Deutschland: Hier hat sich der Schrumpfungsprozess im Verarbeitenden Gewerbe im April laut dem HCOB Einkaufsmanagerindex (PMI) weiter verlangsamt. Der Index stieg auf 48,4 Punkte, den höchsten Wert seit August 2022. Allerdings signalisiert ein Wert unter 50 weiterhin eine Kontraktion des Sektors.
Konjunkturängste bleiben: Rezessionsgespenst geht um
Die Sorge vor einem globalen Abschwung oder gar einer Rezession bleibt angesichts der anhaltenden Unsicherheiten virulent. Jüngste Konjunkturdaten unterstreichen die Fragilität der Lage: Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal überraschend geschrumpft, erstmals seit drei Jahren. Auch Chinas Industrie meldete für April die stärkste Kontraktion seit 16 Monaten. Ökonomen warnen vor den Folgen weiter eskalierender Zölle: Steigende Preise könnten die Konsumausgaben abwürgen, während Unternehmen Investitionen und Neueinstellungen zurückfahren. "Eine Rezession ist zwar nicht unser Basisszenario, aber es wird dieses Jahr eine knappe Angelegenheit", kommentierte etwa Joseph Capurso von der Commonwealth Bank of Australia die Lage. Die am heutigen Freitag noch anstehenden US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls), von denen ein deutlich schwächerer Stellenzuwachs von 130.000 nach 228.000 im März erwartet wird, dürften weitere Aufschlüsse über den Zustand der weltgrößten Volkswirtschaft geben.
Ausblick: Weltwirtschaft am Scheideweg
Die Weltwirtschaft navigiert derzeit durch extrem unsicheres Fahrwasser. Vage Hoffnungen auf eine Deeskalation im Handelskrieg stehen konkreten Konjunkturschäden und wachsenden Rezessionsängsten gegenüber. Die großen Zentralbanken in Asien und Europa stehen bereit, mit weiteren Zinssenkungen gegenzusteuern, doch ihre geldpolitische Munition ist nicht unbegrenzt und die Wirksamkeit in einem von Handelsschranken geprägten Umfeld fraglich. Letztlich hängt die weitere globale wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich von den nächsten politischen Entscheidungen in Washington ab – ein Zustand permanenter Unsicherheit, der die Märkte und Unternehmen weltweit weiter in Atem hält.