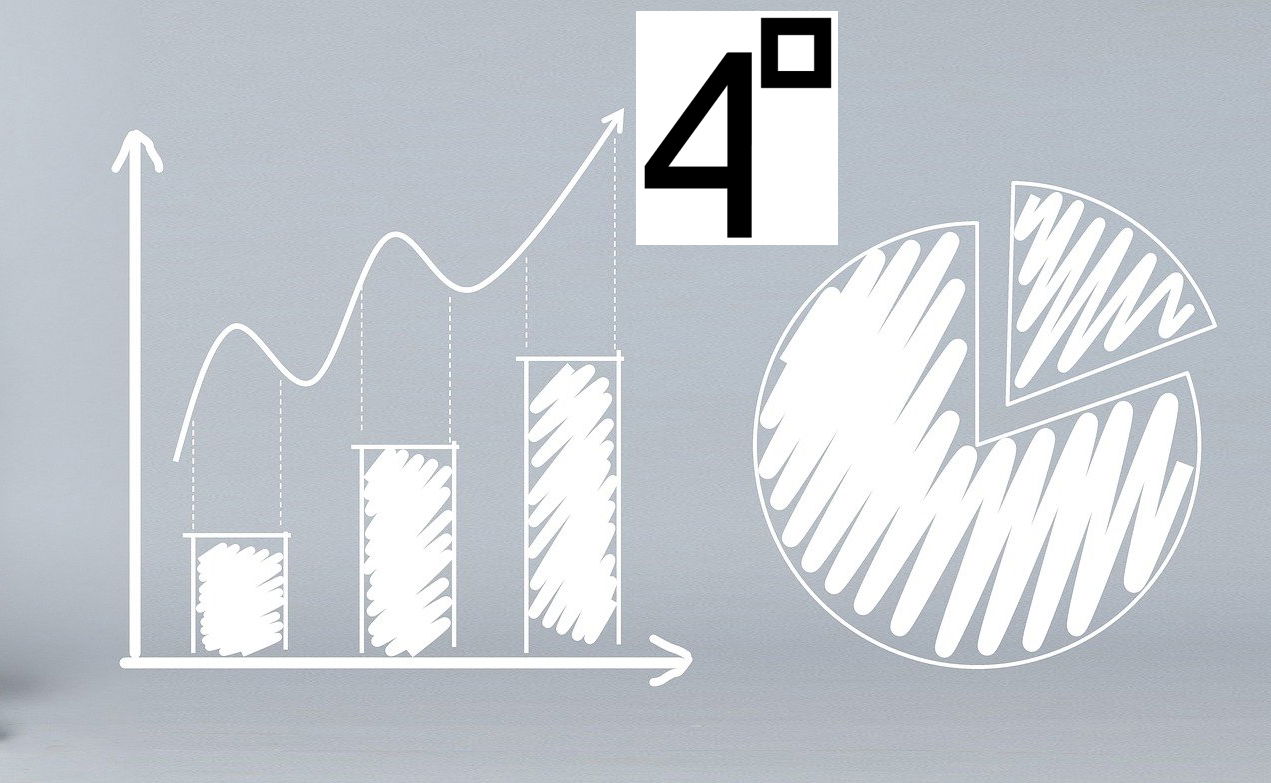Die Unsicherheit kehrt an die Finanzmärkte zurück, angefacht durch die aggressive US-Handelspolitik und deren spürbare Folgen für die globale Wirtschaft. Während Anleger laut Charles Schwab CEO Rick Wurster bereits Risiken abbauen und nervös nach Washington blicken, fordern die Anleihemärkte lautstark Zinssenkungen von der Federal Reserve. Doch die US-Notenbank steckt in der Zwickmühle, gefangen zwischen schwächelnden Konjunkturdaten und der unberechenbaren Zollpolitik von Präsident Donald Trump. Wie tief sind die Bremsspuren wirklich – und droht sogar eine Rezession?
Konjunkturelle Bremsspuren und Fed unter Druck
Die neuesten Wirtschaftsdaten aus den USA zeichnen ein beunruhigendes Bild. Wie am Mittwoch berichtet wurde, schrumpfte die US-Wirtschaft im ersten Quartal unerwartet. Ein wesentlicher Grund: ein historischer Anstieg der Importe, da Unternehmen versuchten, den angekündigten Strafzöllen zuvorzukommen. Doch auch aktuelle Indikatoren deuten auf eine anhaltende Schwäche hin. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe schnellten in der letzten Aprilwoche auf ein Zweimonatshoch (241.000 statt erwarteter 224.000), wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte.
Gleichzeitig signalisiert der wichtige Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (ISM Manufacturing PMI) mit 48,7 Punkten für April weiterhin eine Kontraktion – der fünfte Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50. Laut ISM-Bericht belasten die Zölle Lieferketten und halten die Preise für Vorprodukte hoch, was Sorgen vor einer Stagflation – einer Kombination aus wirtschaftlicher Stagnation und Inflation – nährt.
Angesichts dieser Entwicklung sendet der Anleihemarkt klare Signale. US-Finanzminister Scott Bessent wies am Donnerstag im Interview mit Fox Business darauf hin, dass die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen (ca. 3,57%) mittlerweile deutlich unter dem Leitzins der Fed (Spanne 4,25-4,50%) liegen. "Das ist ein Marktsignal, dass sie denken, die Fed sollte die Zinsen senken", so Bessent. Der Markt preist inzwischen sogar Zinssenkungen um einen vollen Prozentpunkt für dieses Jahr ein – doppelt so viel, wie die Fed-Mitglieder zuletzt selbst prognostizierten. Viele private Ökonomen sehen inzwischen ein erhöhtes Risiko einer Rezession noch in diesem Jahr. Die Fed selbst befindet sich jedoch seit ihrer letzten Zinssenkung im Dezember 2024 in einer abwartenden Haltung, um die Auswirkungen der Trump’schen Zollpolitik auf Inflation und Nachfrage zu bewerten. Ein echtes Dilemma.
Zölle belasten Firmen: LVMH und Polaris spüren Gegenwind
Die Auswirkungen der angespannten Wirtschaftslage und der Handelspolitik treffen Unternehmen direkt. Der französische Luxusgüterkonzern LVMH kündigte für seine Wein- und Spirituosensparte Moët Hennessy einen Stellenabbau von über 10% (rund 1.200 Mitarbeiter) an, wie die Financial Times berichtete. CEO Jean-Jacques Guiony begründete dies intern damit, die Belegschaft auf das Niveau von 2019 zurückfahren zu wollen. Moët Hennessy, die schwächste Sparte im LVMH-Reich, litt im ersten Quartal unter einem Umsatzrückgang von 9%, verursacht durch Einbrüche in den Schlüsselmärkten USA und China. Zusätzliche Belastungen drohen durch die von Trump angedrohten 20%igen Vergeltungszölle auf EU-Waren, was die Sanierungsbemühungen unter Leitung von Alexandre Arnault, Sohn des LVMH-Eigners Bernard Arnault, erschweren könnte.
Auch der US-Powersportfahrzeughersteller Polaris (bekannt für Quads und Schneemobile) bekommt die Probleme zu spüren. Die Ratingagentur S&P Global Ratings stufte die Kreditwürdigkeit des Unternehmens von ‚BBB‘ auf ‚BBB-‚ herab. Als Gründe wurden die erwartete schwache Umsatz- und Ergebnisentwicklung für 2025/26 genannt, bedingt durch das ungünstige wirtschaftliche Umfeld und hohe Zölle, die die Kauflaune für Freizeitgüter dämpfen. Polaris, das stark von Lieferketten aus China abhängt (jährlich ca. 500 Mio. USD), rechnet mit steigenden Kosten und plant, seine China-Abhängigkeit bis Ende 2025 um 30% zu reduzieren. Die Nettoverschuldung droht über die kritische Marke von 4x EBITDA zu steigen, der Ausblick bleibt negativ.
Märkte zwischen Angst und vager Hoffnung
Die Turbulenzen im April haben bei Anlegern Spuren hinterlassen. Laut Rick Wurster, CEO von Charles Schwab, haben Kunden begonnen, Risiken zu reduzieren, US-Aktien zu verkaufen und stattdessen in Anleihen und internationale Aktien umzuschichten. Eine Schwab-Umfrage im April ergab, dass 61% der befragten Kunden "bearish" gestimmt waren, verglichen mit nur 32% im ersten Quartal. Die größte Sorge sei die politische Landschaft in Washington. "Anleihen sind zurück", kommentierte Wurster das wiedererwachte Interesse an festverzinslichen Wertpapieren.
Am Devisenmarkt zeigte sich am Donnerstag ein gemischtes Bild. Der US-Dollar legte gegenüber den meisten Hauptwährungen zu, trotz der schwachen heimischen Wirtschaftsdaten. Händler verwiesen auf die Hoffnung auf mögliche Handelsabkommen der USA mit Partnern wie China, Indien, Südkorea und Japan, über die Präsident Trump am Mittwoch gesprochen hatte. Diese könnten die negativen Auswirkungen der Zölle abmildern. Treasury Secretary Bessent und Wirtschaftsberater Kevin Hassett äußerten ebenfalls vorsichtigen Optimismus bezüglich einer Entspannung. Zwar dementierte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer am Mittwoch offizielle Gespräche mit China, doch staatsnahe chinesische Medien berichteten am Donnerstag, die USA hätten Gespräche wegen der Zölle gesucht.
Gleichzeitig geriet der japanische Yen unter Druck. Die Bank of Japan (BoJ) beließ die Zinsen wie erwartet unverändert, senkte aber ihre Wachstumsprognosen unter Verweis auf die US-Zölle. Die Hoffnung auf baldige Zinserhöhungen in Japan schwand damit, was den Yen auf ein Vierwochentief zum Dollar (über 145 Yen pro Dollar) und ein Monatstief zum Euro (über 164 Yen pro Euro) drückte.
Ausblick: Politische Agenda bestimmt den Takt
Die kommenden Wochen dürften weiterhin von der US-Handelspolitik und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Verwerfungen geprägt sein. Während Präsident Trump parallel seinen Haushalt für 2026 an den Kongress schickt und mit der Nominierung seines Nationalen Sicherheitsberaters Mike Waltz zum UN-Botschafter weitere politische Pflöcke einschlägt, warten die Märkte gespannt auf Signale der Deeskalation im Handelsstreit. Die Hoffnung auf Deals stützt derzeit zwar den Dollar, doch die realwirtschaftlichen Daten und die Risikoaversion der Anleger senden Warnsignale. Die entscheidende Frage bleibt: Gelingt eine diplomatische Lösung, oder driften die USA und ihre Handelspartner weiter in eine Spirale aus Zöllen und Gegenmaßnahmen, die letztlich die globale Konjunktur abzuwürgen droht? Die Federal Reserve wird die Entwicklungen genau beobachten müssen, bevor sie ihren nächsten Schritt wagt. Das Ringen zwischen politischem Willen und ökonomischer Vernunft geht in die nächste Runde.